
Dienstag, 03.05.2005
Ingrids letzter Brief auf die KrimKarsten Packeiser, Moskau. Heinrich Schmidt und Kusma Turajew waren zwei der Millionen Soldaten, die nicht aus dem Krieg heimkehrten. Doch statt aufeinander zu schießen, hatten sie die Waffen beiseite gelegt.
|
Als der Reporter Jewgeni Jakowlew im Frühjahr 1961 mit seinem Motorrad durch die südukrainische Steppe knatterte, um über den Bau des Krim-Kanals zu berichten, wusste er noch nicht, dass er sich an diesen Tag noch viele Jahrzehnte erinnern würde. Noch über vierzig Jahre später hat Jakowlew, der inzwischen in Rente gegangen ist, ein großes Ziel: Er will die Kinder zweier Weltkriegssoldaten finden, um ihnen das Grab ihrer Väter zu zeigen und ihnen zu sagen, dass die beiden Männer im Krieg zwar durch die Hölle gingen, aber dabei doch Menschen blieben.
Um die Landzunge von Perekop hatte es im März 1944 heftige Kämpfe zwischen der vorrückenden Roten Armee und der Wehrmacht gegeben. Zehntausende deutscher und russischer Soldaten waren hier umgekommen. Immer wieder stießen die Planierraupen und Bagger der Kanalbauer auf Kriegsschrott und Knochen, so auch an jenem Tag, als ein Bulldozer die massiven Holzwände eines Bunkers freilegte. Jakowlew war der erste, der in den Bunker kletterte, als der Eingang freigegraben war. „Die Wände waren mit Brettern verkleidet, auf dem Boden lag abgenutztes Stroh“ erinnert sich der Journalist, „den abgerissenen Telefonkabeln und den zerschlagenen deutschen Funkgeräten nach handelte es sich um einen deutschen Kommandopunkt.“
 Im Bunker verschüttet Im Bunker verschüttet
Auf einer Holzpritsche in der Ecke des Bunkers entdeckte Jakowlew schließlich zwei Skelette, eines in russischer und eines in deutscher Uniform, zwischen ihnen lagen verrostete Konservendosen, die mit dem Bajonett des deutschen Soldaten geöffnet worden waren und je eine deutsche und eine sowjetische Feldflasche. Beide Soldaten hatten wahrscheinlich bei den Gefechten in dem Bunker Zuflucht vor dem Kreuzfeuer gesucht, waren dann verschüttet worden und konnten sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien.
Wie lange der Rotarmist und der Wehrmachtssoldat in dem Bunker zusammen ausharrten, bis die letzte Kerze erlosch, der letzte Proviant und womöglich auch die letzte eiserne Wodka-Ration aufgeteilt war, ist unbekannt. Womöglich waren es mehrere Tage. 17 Jahre nach den Kämpfen lehnten noch ein deutsches Gewehr und ein sowjetisches Maschinengewehr an der Wand des Bunkers. Beide Waffen waren entsichert und vollständig geladen. „Sie hätten beide schießen können, aber keiner von ihnen hat es getan“, sagt Jakowlew.
Mama arbeitet viel und betet
Am sowjetischen Uniformmantel steckte noch ein „Roter Stern“-Orden und eine Tapferkeitsmedaille. In der Manteltasche fand Jakowlew einen Abschiedsbrief, den der Unterleutnant Kusma Turajew mit Bleistift an seine Eltern in Kuibyschew (dem heutigen Samara) an der Wolga geschrieben hatte. In dem Schreiben bat der Soldat um Vergebung für alles, was er in seiner Kindheit falsch gemacht hatte. Die Liebe zu seiner ganzen Familie nehme er mit hinüber ins Jenseits, schrieb Turajew mit schon zitteriger und entkräfteter Hand.
Der Deutsche war bei den Kämpfen offenbar verletzt worden. Mit der Hand hatte er sich zuletzt die Brust gehalten, dort steckte auch eine Geldbörse, die von einem Metallsplitter zerrissen war. In seinen letzten Stunden hatte der Soldat Heinrich Schmidt einen Brief seiner Tochter Ingrid bei sich getragen, den Jakowlew später von einem Kriminallabor entziffern ließ:
„Mein lieber Papa“, schrieb das schätzungsweise sieben- oder achtjährige Mädchen am 14. Februar 1944, „jetzt haben wir endlich Frühling, die Blumen haben begonnen zu blühen und wir frieren fast nicht mehr. Opa und Oma sind krank, sie lassen Dich grüßen. Mama arbeitet viel und betet, dass Deine Seele gerettet wird. Der kleine Dieter fragt oft nach Dir. Ich gebe mir Mühe, in der Schule gut zu sein. Ich habe Dich lieb und will ganz ganz stark, dass Du schnell gesund nach Hause kommst.“ Wahrscheinlich habe Schmidt den Kinderbrief allen seinen Kameraden gezeigt, glaubt Jakowlew, und sicherlich habe Ingrid ihrem Vater noch mehr Briefe an die Ostfront geschickt - aber die kamen bereits nicht mehr an.
Es fehlten nur einhundert Kilometer
In Turajews Tasche lag auch noch eine Ausgabe der Frontzeitung „Sa Rodinu (Für die Heimat)“ vom März 1944, in der der Heldenmut der Sowjetarmee beschworen und die Armee aufgefordert wurde, die Krim noch schneller zu befreien. „Ich war damals furchtbar betroffen, dass unsere Soldaten es nicht geschafft hatten, rechtzeitig bis Simferopol vorzurücken, um meinen Vater zu retten“, erinnert sich Jakowlew, „dabei fehlten nur etwas mehr als einhundert Kilometer.“
Jakowlews Vater Nikolai war umgekommen, als der spätere Reporter elf Jahre alt war - etwa zur selben Zeit, als auch Turajew und Schmidt starben. Gestapo-Agenten hatten den damals 37 Jahre alten Mann verschleppt, kurz bevor die deutschen Truppen die Krim-Hauptstadt Simferopol aufgaben. Vor seinem Tod brannten ihm Folterknechte mit einem glühenden Eisen Hammer und Sichel in den Rücken und einen Stern in die Brust und rissen ihm die Fingernägel aus. Jewgeni Jakowlew fand die entstellte Leiche seines Vaters später in einem Massengrab nicht weit von der Stadt. „Damals ging meine Kindheit zuende“, sagt er heute.
In den kommenden Jahren, als die Krim noch in Ruinen lag und es kaum etwas zu essen gab, wuchs Jakowlew mit seinen Großeltern auf. Damals habe er begriffen, dass es das schlimmste im Leben eines Menschen ist, das eigene Kind zu begraben. „Und dieser verfluchte Krieg hat dutzende Millionen unschuldiger, guter, schöner, talentierter Menschen vernichtet.“
Heimliche Beerdigung in der Nacht
In der Nacht, nachdem Jewgeni Jakowlew die beiden toten Soldaten gefunden hatte, machte er sich mit einem Spaten ausgerüstet ein zweites Mal auf zu dem Bunker und beerdigte die beiden Gefallenen in einem gemeinsamen Grab. Alles musste heimlich geschehen, denn fünfzehn Jahre nach Kriegsende, während der Hochphase des Kalten Krieges hätte es seine Karriere und das Parteibuch kosten können, dass er sich mit den Knochen eines feindlichen Soldaten abgab. Bis heute kennt niemand außer ihm den Ort, an dem der Wehrmachtssoldat Heinrich Schmidt und der Rotarmist Kusma Turajew ihre letzte Ruhe fanden.
Später schrieb Jakowlew sogar einen Beitrag über die beiden Soldaten in der sowjetischen Regierungszeitung „Iswestia“, aber keiner der Angehörigen meldete sich. Bis heute würde er sich freuen, wenn er den Kindern Turajews und Schmidts das Grab ihrer Väter zeigen könnte. „Die beiden haben ihren Krieg wie Menschen beendet und Frieden geschlossen“, sagt er. Dieses Wissen würde er gerne mit denen teilen, die vergeblich auf ihre Väter warteten.
(kp/.rufo)
|
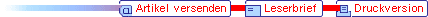
|
|
|
Schnell gefunden
|


